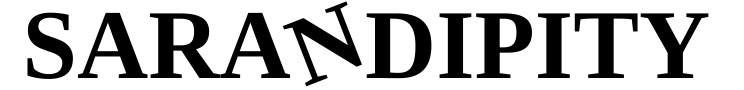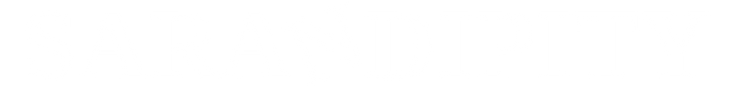Über Kommunikation, Exformation, Deutungshoheit und die Gefährlichkeit kontextloser Verständigung
Ich bin oft sprachlos – nicht, weil mir die Worte fehlen, sondern weil ich zusehe, wie wir mit ihnen umgehen. Wie wir sprechen, wo wir schweigen, was wir betonen, und was wir nicht einmal mehr merken. Kommunikation ist unser Überlebenstool, unser Binde- und Bedeutungsglied. Heute wirkt sie wie ein Markt – jeder postet, einige liken, und alle verhandeln ihren Wert.
In Zeiten, in denen künstliche Intelligenz unsere Texte schreibt, unsere Gespräche simuliert und unsere Entscheidungen vorbereitet, wird eines schmerzlich sichtbar: Es sind nicht unsere Technologien, die ausgefeilter sein müssen. Es sind unsere menschlichen Fähigkeiten, die erodieren. Und allen voran: unsere Fähigkeit, miteinander zu sprechen – und das bedeutet nicht nur reden, sondern bedeutsam kommunizieren.
Exformation als Boden – und was passiert, wenn keine da ist
Tor Nørretranders beschreibt mit dem Begriff Exformation das Paradox moderner Verständigung: Kommunikation funktioniert nicht über das, was gesagt wird, sondern über das, was weggelassen werden kann, weil es geteilt ist. In diesem unausgesprochenen Raum liegt Bedeutung, Vertrauen, Verbundenheit.
Doch was geschieht, wenn wir nicht mehr wissen, was geteilt ist? Wenn der gemeinsame Erfahrungsboden erodiert, wenn kulturelle Codes zersplittern und digitale Räume Bedeutungen verschieben?
Wir benutzen dieselben Begriffe – aber nicht mehr dieselben Kontexte. Wir sagen „Freiheit“, „Verantwortung“, „Würde“, ohne zu prüfen, aus welchem Rahmen, Kontext oder biografischer Bedeutung sie ursprünglich stammen. Die Exformation, die tragende Bedeutungstiefe, ist verschwunden.
Wir verlieren nicht nur unser Gegenüber – wir verlieren uns selbst. Denn auch Identität ist kontextgebunden. Und wer keine Verankerung im sprachlichen Raum hat, verliert das Echo seiner eigenen Worte.
Die sprachliche Verankerung aber, ist der belebte Raum zwischen Autarkie und Gemeinschaft. Es sind bereits physische bio-chemische Prozesse die darauf reagieren, wenn wir nicht gebunden sind. Die hinkende sprachliche Lösung sind momentan mehr Labels und scharfe Positionierungen.
Wir Menschen sind Tiere, die Teil von etwas Größerem sein müssen. Nicht als Funktion, sondern als Idee und Glaube. Wir brauchen dringend die sicheren Bedeutungsräume – hier können wir nicht warten! Und, wenn auch ein Like mich nur noch verwaltet, dann verbinde ich mich über ein Label, über eine Position.
Ohne die Reflektion und die Absicherung unseres Selbstwertes, bekommt die Existenzberechtigung Herzflimmern. Da funktioniert die nächste Hetzkampagne wie eine Herzdruckmassage – Lieber ein paar Rippen gebrochen als das Leben gelassen.
Aber vielleicht ist es nur eine Panikattacke, eine Überforderung, Aufregung aus Müdigkeit oder eben das Liebesbedürfnis. Die gemeinschaftliche Kommunikation, die wertschätzende Debatte gehört trainiert – wie eben der Herzmuskel. Mit der Menschlichkeit als wiederkehrendem Impuls – ohen Eskalation, sondern mit Vision!
Die Erosion der Bedeutung: Was bleibt, wenn der Kontext fehlt?
Was übrig bleibt, ist eine Sprache der Oberfläche. Wiedererkennbare Wörter mit schwindender Tiefe. Begriffe als Etiketten. Diskurs als Design. Und das Tragische: Wir merken es nicht einmal. Denn auch unsere Werkzeuge zur Bedeutungsprüfung – Bildung, Geschichte, Gemeinschaft und soziale Räume – sind fragil geworden. Unzeitgemäß.
Wir erleben einen Zustand, den man als exformative Verblödung bezeichnen könnte: Wir wissen vieles, aber wir verstehen nichts mehr. Wir können zitieren, aber nicht einordnen. Wir haben Zugriff auf alle Worte, aber keine Beziehung mehr zu ihrem Ursprung oder Ausmaß. Der Dunning-Kruger Effekt beschreibt, warum wir dennoch funktionieren.
Was passiert, wenn sich Sprache vom Körper trennt? Wenn sie nicht mehr aus Erfahrung entsteht, sondern aus strategischer Platzierung? Wenn der lose Post sich seinen Kontext suchen muss? Wenn Wörter von Bühnen herunter gesprochen werden, deren Architektur wir nicht mehr kennen – aber deren Echo uns trotzdem erreicht?
Sprache dringt durch alle Schichten – und lässt keine Metaebene zu
Hier wird etwas deutlich, das wir oft übersehen: Sprache ist nicht nur ein Werkzeug – sie ist ein Vorgang. Ein Prozess, der in uns geschieht und gleichzeitig uns formt. Worte durchdringen unsere frühesten Überlebensfähigkeiten, strukturieren später unser Selbstbewusstsein und formen irgendwann unsere gesellschaftlichen Narrative. Hinter jedem Wort entfaltet sich in jedem Einzelnen eine Bedeutung, etwas, das in unserem Gehinr Struktur finden will. Wir – unser Körper – bringt dafür Energie auf und das macht müde. Es bleibt wenig übrig, um hochzufahren oder abzukühlen. Lieber genießen wir lauwarm, bleiben unberührt als verletzt und dadurch rausgeworfen aus der Funktionskette.
Wir können uns also nicht „kurz mal rausnehmen“, analysieren, und dann wieder einsteigen – denn Sprache passiert auch in uns, nicht nur durch uns. Es gibt keine echte Metaebene, keinen neutralen Außenstandpunkt. Und das macht Kommunikation so gefährlich wie notwendig: Sie betrifft uns, bevor wir sie bewusst gestalten.
Was bedeutet das für unser Selbstbild? Wer sind wir, bevor wir sozialisiert, angesprochen, geformt wurden? Gibt es überhaupt ein „per natura Ich“ – oder ist unser Wesen immer schon gefärbt von Sprache, Kontext, Beziehung?
Die Bühne verschiebt sich – das Wort bleibt
Michael J. Sandel beschreibt in seiner Kritik am Leistungsdenken, wie Macht sich über Sprache legitimiert. Wer als erfolgreich gilt, darf sprechen. Und wessen Sprache gehört wird, der schreibt das moralische Skript der Gesellschaft.
Doch was, wenn diese Sprecher ihre Begriffe verschieben? Wenn positive Worte – „Gerechtigkeit“, „Verantwortung“, „Gemeinschaft“ – von Menschen genutzt werden, die auf einer Bühne stehen, deren Regeln völlig andere sind als die der Zuhörenden?
Das Gefährliche daran ist nicht nur der Missbrauch der Begriffe. Es ist, dass wir diese Begriffe in unseren Kontext übernehmen, ohne zu bemerken, dass sie bereits anders gefüllt wurden. Die Worte bleiben gleich – die Bedeutung wandert. Und mit ihr die Macht.
Sandel spricht davon, wie sich Demokratie in ein moralisches Meritokratie-Spiel verwandelt hat: Wer gewinnt, hat recht. Wer verliert, hat nicht genug getan. Sprache wird so zur Oberfläche eines Systems, das Ungleichheit durch Wortwahl tarnt.
Deutungshoheit – wem gehören die Worte?
Es ist nicht nur was von wem, zu welchem Anlass gesprochen wird, es ist auch – wer hört was. Das Zuhören ist Teil einer wertschätzenden, konstruktiven Kommunikation. Auch das Zuhören ist in Schieflage geraten. Der mediale Auftritt von sogenannten Nachrichten (Neuigkeiten), gleicht immer mehr einem Drogentrip in Fast Forward. Ja genau – am besten Bindung in doppelter Geschwindigkeit (bis jetzt gibt es nur 2x).
Es sind also einerseits die inhaltlichen Verschiebungen an Bedeutung, aber auch die emotionale Dauernarkose, die verabreicht wird. Gaza – Foodskandal – Cum Ex – Amokfahrt. Das alles passt in 1:30, anmoderiert von einem ruhiggespritzen Gesicht.
Ich halte das für gefährlich und verantwortungslos in allerhöchstem Maße! Es verschwimmt dadurch die Möglichkeit, den Selbst- und den Gemeinschaftsbezug in Austausch zu bringen, verschiedene Dimensionen der sprachlichen Kommunikation in Kontakt zu bringen. Das Dilemma auszuhalten und seine eigenen Wirkkreise zu erkennen.
Die sogenannte Deutungshoheit – also das Recht, zu bestimmen, was etwas bedeutet – wird nicht verliehen, sie wird erzeugt. Durch Status. Durch Bühne. Durch Wiederholung. Durch Frequenz. Und oft genug durch den Entzug von Alternativen oder sprachlicher Eskalation. Alles eine Krise!
Was passiert, wenn wir diesen Kontext nicht mehr prüfen? Wenn wir Sprache hören, aber nicht mehr fragen, wer spricht – und warum genau jetzt?
Narrative als Maßstab – Rehabilitierung statt Gemeinschaftswohl?
Ein besonders aufschlussreiches Beispiel für sprachliche Verschiebung zeigt sich im Umgang mit Schuld und Vergebung. Unsere Gesellschaft hängt auffällig stark am Narrativ der Rehabilitierung – so sehr, dass Täter schneller neue Chancen bekommen als Opfer Gerechtigkeit, friedliche Menschen weniger Aufmerksamkeit als extrovertierte Extremisten.
Wenn eine öffentliche Figur einen „unverzeihlichen Fehler“ macht – etwa durch sprachliche Entgleisung oder ideologische Grenzverwischung – wird dieser Fehler in den öffentlichen Kommentaren nicht selten als Fauxpas verharmlost. Ein Glas Wein später ist alles vergessen. Und genau darin liegt die sprachliche Dynamik: Die Entgleisung wird nicht durch Argumentation, sondern durch Stimmung entwertet. Die Bühne bleibt – der Kontext wird gelöscht. Dabei ist es eben genau dieser Kontext, der es überhaupt bedeutend und sogar gefährlich macht! Sprachliche Entgleisungen sind wie eine vergiftete Leber. Sie sifft in den ganzen Körper und ist letztlich irreversibel. Die Gesellschaft verschiebt sich und merkt es nicht einmal. Die nächste Flasche steht schon bereit.
Aber auf welcher Ebene funktioniert so etwas? Und wie tief greift die sprachliche Codierung in unsere moralische Bewertung ein?
Hier sind wir mitten in der Sprachwissenschaft: Es sind die ganz kindlichen Fragen, die uns dahinführen. Bedeutungen entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern in sozialen Feldern. Und wer diese Felder kontrolliert, bestimmt, was als harmlos gilt – und was als schwerwiegend (und natürlich über die Konsequenz). Auch das ist Deutungshoheit.
Kontexte und Sprachliche Spiele
Kommunikation ist immer ein agreement ein Einverständnis. Lautstark oder im Geheimen. Es ist vielleicht ein Anhaltspunkt zu prüfen, welchen systematischen Raum die Position hat und darin eine Persönlichkeit zu erkennen. Selbst die festgestellten Grenzen sind letztlich eine Verbindung.
Aaron Swartz schrieb auf seinem Blog, dass es natürlich ein Dilemma sei. Die Menschen, die sich in einem überstehenden Amt sehen oft nicht diejenigen sind, die sich um die Menschen und ihre Belange tatsächlich kümmern wollen. Sie brauchen diese Position oft für sich. Sie bleiben wenig dynamisch, haben wenig Skin in the Game, wie Nassim Nicholas Taleb sehr treffend in seinen Büchern rausarbeitet.
Hegel zeigte bereits, dass der „Herr“ auf die Anerkennung des „Knechts“ angewiesen ist – auch sprachlich. Ohne Resonanz keine Autorität. Und doch wirken viele Sprecher heute, als stünde ihnen die Bedeutung naturgemäß zu. Doch stellt man ihre Aussagen in einen anderen Kontext, wird klar: Dort wären sie nicht anschlussfähig. Ihre Wirkung lebt allein von der Struktur, in der sie ausgesprochen werden.
Die Macht der Kommunikation liegt in ihrer Verbannung
Ein beunruhigendes Muster zieht sich durch autoritäre und funktionalisierte Systeme: Sprache wird zuerst reduziert. Zensur.
Nicht nur durch Zensur. Sondern subtiler: durch Kontextlosigkeit. Erst verlieren Worte ihre Tiefe. Dann verliert das Gespräch seinen Wert. Dann wird Kommunikation selbst zur Gefahr – weil sie Beziehung schafft. Und Beziehung macht abhängig. Unkontrollierbar. Offen.
Dabei ist Zensur, Wortverneinungen und Entlehung selbst ein Akt der Kommunikation.
Es bleibt uns aber immer der Dialog, die Gemeinschaft, Werte der Menschlichkeit. Es sind diese alltäglichen Dinge, die unserer Kommunikation die liebenswerte Kraft verleihen. Dran an der Bedeutung, an seinem Selbstwert und dem des Anderen. Ein gemeinsames Abendessen. Ein gemeinsamer Gesang im Stadion. Ein gemeinsames Nebeneinandersitzen. Ein Lächeln an der Supermarktkasse.
Let’s make each other bedeutsam again.