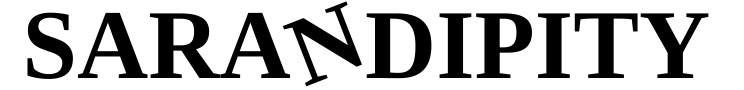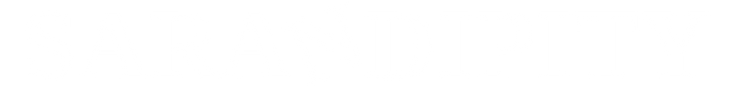Es war einer dieser aufregenden Abende. Eigentlich begleitete sie einen Freund zur Geschäftsfeier. Langsam stürzte sie sich ins Getummel, als klar wurde, dass er sich um eine Verflossene kümmern würde. Sie wusste, dass sie heute heiß aussah, dass sie sprühte vor Tanzlaune und bemerkt hatte, dass andere schon Blickkontakt aufnahmen.
Als sie sich vom Tanzen eine Pause gönnte, nahm sie das breite Grinsen am Stehtisch wahr. Ein alter Kollege.
“Hey”, sagte er.
“Hey”, erwiederte sie.
“Schau mal, mit wem ich hier bin”. Und er bat einen Mann an den Tisch. “Mirko”, stellte er sich vor.
“Ach, der Mirko, der mir seit zwei Jahren einen Kasten schuldet?”
Ja, sie erinnerte sich daran. Sie erinnerte sich daran, dass sie diesem Freund damals eine Praktikumsbescheinigung für sein Studium ausstellte. Mit einem charmanten, aufmerksamen Lächeln schwieg er sie an, fing sie mit seinen Blicken ein.
Zwei Tage später hörte sie von ihm. Eine SMS: Hey, ich dachte ich zeige mich erkenntlich. Wollen wir aus dem Kasten einen Grillabend machen?
Sie wusste, dass dahinter mehr stecken würde und sie mochte das. Cool antworte sie: Na klar. Wird ja Zeit…
Aus dem Grillabend wurde eine gemeinsame Adresse.
Sie erzählte gerne von diesem ersten Treffen. “Ich wusste direkt: Das ist mein Mann”. Sie liebte diese intensive Romantik, diese Geschichten, die das Leben aufregend und lebendig erschienen ließen. Unter ihrer tiefen Überzeugung verlor sie nicht nur die Realität, sie verlor auch sich.
Er bewegte sich schnell, so wie jemand, der jederzeit zur Flucht bereit war. Seine Worte waren keine kleinen Sätze, sondern Räume, die er ihr hinwarf, Bruchstücke, die sie füllte, weil es ihre Art war, zu deuten, zu verstehen, zu ergänzen, und in diesen Lücken, zwischen dem, was er sagte, und dem, was er verschwieg, entstand ein Bild, das größer war als er selbst, ein Bild, das sie trug, das sie in sich nährte, mit jedem Tag ein wenig mehr.
„Ich brauche Weite. Die meisten Beziehungen fallen in eine ungesunde Abhängigkeit, wo sie nörgelt und er nicht mehr fei ist,“ sagte er einmal, während er den Rucksack packte, „ich gehe pokern. Ich brauche das für mich. Nicht so ein normales Leben,“ und sie nickte, weil das Nicken ihr vertraut war, weil es einfacher war, zu nicken, als zu fragen, weil es ein Zeichen war, dass sie verstand, dass sie die Frau war, die losließ, die nicht fesselte, die nicht forderte, die ihn sein ließ, so wie er sein wollte, und darin lag ein Stolz, ein leiser, aber fester Stolz, der ihr sagte, dass Liebe genau das bedeutete.
In ihr lebte eine Wahrheit, eine leise, aber mächtige Wahrheit, von der sie nicht wusste, woher sie kam, ob aus den Erzählungen der Frauen, die sie als Kind beobachtet hatte, während sie still an Küchentischen saßen, den Blick auf ihre Männer gerichtet, oder aus den Geschichten, die sich zwischen den Zeilen von Märchen und Predigten verbargen, eine Wahrheit, die sich wie ein Gebot anfühlte, wie eine Aufgabe, die ihr übertragen worden war: dass eine gute Frau versteht, dass eine gute Frau wartet, dass eine gute Frau hält, auch dann, wenn der andere noch nicht bei sich angekommen ist.
Als er ihr schrieb, schon unterwegs, schon weit, schon fort, dass er überlege, “seinen Teil” der Wohnung unterzuvermieten, während er weg sei, da las sie die Nachricht einmal, las sie ein zweites Mal, legte das Handy weg, nahm es wieder auf, sah die Worte an, die wie Steine auf ihre Brust fielen, während ihr Kopf längst wusste, was es bedeutete, während ihr Herz suchte, wie es diese Worte mit ihrer Wahrheit versöhnen konnte, und ihre Finger tippten zaghaft zurück: Unsere Wohnung?
Er antwortete erst später, als der Tag sich neigte, als das Licht schon schräg durch die Fenster fiel: Praktisch. Geld fürs Nichts.
Etwas in ihr zog sich zusammen, ein leises Ziehen, ein kaum merklicher Riss, der keinen Ton machte, aber spürbar war, doch sie sprach es nicht aus, sie schwieg, sie erklärte es sich selbst, dass es Sinn ergab, dass er eben so war, dass Freiheit nun einmal Raum brauchte, dass er größer dachte, weiter, mutiger, dass sie es nicht einengen durfte, wenn sie ihn lieben wollte, und so redete sie ihn gut, nicht nur vor anderen, sondern vor sich, redete ihn gut, wenn Freunde fragten, wo er sei, redete ihn gut, wenn sie allein am Tisch saß, redete ihn gut, als wäre jede Verteidigung ein Baustein für das Bild, das sie von ihm trug, das sie zu schützen glaubte, als würde jede Entschuldigung ihn irgendwann näherbringen, als würde jedes Gutreden ihr eines Tages den Lohn schenken, den sie erhoffte.
Er sprach oft davon, dass er anders sei, dass er “kein normales Leben” wolle, dass er nicht gebunden sein könne, dass er seinen eigenen Weg brauche, dass er die Freiheit brauche, die ihm keiner nehmen dürfe, und sie bewunderte ihn dafür, bewunderte seine Unangepasstheit, seine Weigerung, sich zu fügen, seine Sehnsucht, die größer war als ihre eigene, seine Träume, die in andere Richtungen liefen, und sie dachte, dass es genau diese Größe war, die ihn zu dem machte, was sie liebte.
Er erzählte von Poker, von Karten, von Gewinnen, von Möglichkeiten, von einem Leben, das sich jeden Tag neu entwarf, und während er sprach, schwieg sie, nahm seine Worte auf, trug sie in sich, auch dann, wenn sie nicht wusste, wohin damit, und als er vom Haus seiner Mutter, das bald ihm gehören würde. „Ich hab meinen Vater überzeugt,“ sagte er, als wäre es selbstverständlich mit einem Lebenden über sein zu Hause zu verhandeln. Oft spürte sie, dass die Wahrheit nicht mir ihren Wünschen kompatibel war. Zu akzeptieren, wie er sich in der Welt sah, bedeutete auch, zu akzeptieren, dass sie hier nichts finden würde.
Es war die Nähe, die sie immer wieder band, die Körperlichkeit, die wie ein Knoten war, der alles zusammenhielt, der alles erklärte, was Worte nicht sagten, der sie in ihm verankerte, der sie glauben ließ, dass Liebe genau dort lag, wo Haut auf Haut traf, wo Wärme floss, wo Schweigen bedeutungslos wurde, wo ein Höhepunkt garantiert war, solange es Hände gab, die sie hielten.
Bis zu jener Nacht, nach der Geburtstagfeier ihrer Freundin, als der Wein schwer war, der Schlaf schnell kam, als ihr Körper träge lag, zwischen Wachen und Dämmern, und er zu ihr kam, die Hose herunterzog, sich auf sie setzte, in sie drang, während ihre Glieder weit weg waren, während ihre Gedanken sich verloren, während keine Stimme mehr rief, kein Widerstand mehr sprach, und er sich nahm, was er wollte, sich zurückzog, ein Tuch holte, sie abwischte, ohne ein Wort, ohne einen Blick, als wäre es Teil eines Rituals, das keine Sprache kannte. Es nahm sich was er wollte, markierte sie.
Am Morgen lag Stille zwischen ihnen, die größer war als die Nacht.
Es war im gemeinsamen Urlaub. Was ihr Kopf nicht zuließ, was ihre Logik ihr als Argumente präsentierte, ließ der Körper nicht mehr zu. Ihr Körper verließ ihn. Es gab keine Höhepunkte mehr. Ihr Körper nahm ihn an, bewegte sich, doch beide merkten. Sie ist da, aber nicht anwesend. In seinen Augen sah sie, dass nicht nur sie ihre Sexualität als Bindeglied verstand. Es verunsicherte ihn. Ihre Verlässlichkeit wurde ihr selbst verwährt.
Ihr Körper sprach für sie. War es die Umgebung, der Ort, eine Phase? Sie kannte sich so nicht. Keine Aufregung während er sie berührte, während er sie suchte, während er in ihr war, und er spürte es, auch ohne Worte, spürte das Weggleiten, die Abwesenheit, die größer wurde, auch wenn sie blieb.
„Ich gehe pokern,“ sagte er eines Morgens, die Tasche wieder auf der Schulter, die Tür halb geöffnet, „ich muss mich um meine Karriere kümmern,“ und er ging, und diesmal kam er nicht zurück.
Sie saß zwischen den Dingen, die er nie mitgebracht hatte, zwischen Räumen, die ruhig blieben, zwischen Fragen, die keine Antwort fanden, suchte nach Momenten, in denen sie zu wenig war, zu viel, zu falsch, in denen sie hätte anders sein können, suchte nach Fehlern, nach Wendepunkten, nach einem Satz, der alles erklärt hätte, und doch blieben die Fragen kreisend, ohne Boden.
Während sie hier auf dem Sofa saß, sich einen Cappuccino gemacht hatte, stellte sie beiläufig fest, dass sie kaum etwas vermisste. Alles stand da wie immer. Nur er fehlte. “Was hatte er mitgebracht? Was würde er hinterlassen”, fragte sie sich.
Die Hoffnung war es, die sie am meisten genährt hatte, die Hoffnung, dass all das Warten, das Unterstützen, das Gutreden, das Verstehen eines Tages den Lohn bringen würde, dass sie eines Tages eine gute Frau sein würde, dass er eines Morgens vor ihr stehen würde, mit offenen Augen, mit offenen Händen, und sagen würde: Ich habe es gesehen. Ich habe dich gesehen.
Doch er kam nicht.
Was kam war die Scham und die Schuld. Sie schämte sich – am meisten vor sich selbst! Sie schämte sich aus zwei Gründen: Sie wurde weder die gute Frau, noch alleine glücklich. Sieben Jahre gingen an ihr vorbei in denen sie sich paralisiert an seine Seite quetschte, ihre Bestimmung suchte und mehr den Regeln des guten Lebens, als sich selbst folgte. Sie hatte sich schuldig gemacht und das war noch schlimmer als die erlebten Jahre. Die Wahrheit, dass sie jemanden suchte, der sich um sie kümmerte, sie annahm, jemand, der sie mit liebenden Augen beobachten würde. Sie selbst hätte das sein müssen. Die Wahrheit lag nie in der Geduld, nie im Aushalten, nie im Gutreden, vielleicht war die Wahrheit ganz woanders, jenseits der Hoffnung, jenseits der Pflicht, jenseits der Rolle, die sie geglaubt hatte, erfüllen zu müssen.
Vielleicht hatte sie die Prämissen falsch gedeutet. Vielleicht hat sie perfekt in sein Spiel gepasst.
Für sie war es kein Spiel. Es war ihr Leben.
Vielleicht war es nur ein Teil einer Erzählung, die jemand brauchte, damit er nehmen konnte, ohne zu geben.
Und während sie in die Dunkelheit sah, spürte sie, dass sie lernen sollte, dass Liebe keinen Beweis schuldet, keinen Lohn verspricht, keinen Sieg kennt.
Und dass Freiheit dort beginnt, wo viele Narrative möglich sind.