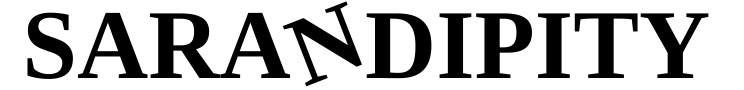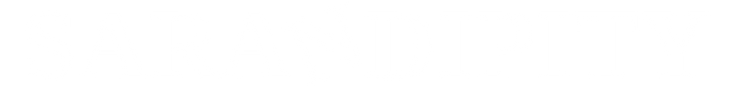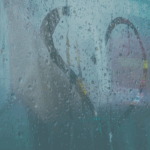Manchmal sind die größten Wunder so selbstverständlich, dass wir sie gar nicht mehr sehen. Zum Beispiel: dass wir miteinander reden können. Wir nehmen es meist als gegeben hin – so wie Leitungswasser. Erst wenn es ausbleibt oder schiefgeht, merken wir: Oh. Ohne geht’s nicht.
So ist es auch mit der Kommunikation. Sie scheint immer da, und genau deshalb nehmen wir sie für selbstverständlich. Wir reden, wir schreiben, wir posten – und merken oft gar nicht, dass wir uns damit gegenseitig Welten bauen. Der Linguist Benjamin Lee Whorf schrieb schon in den 1940ern: „We dissect nature along lines laid down by our native language“ (Whorf, Language, Thought, and Reality, 1956). Mit anderen Worten: Sprache ist nicht nur das, womit wir über die Welt reden. Sie ist das, wodurch wir die Welt überhaupt erst so wahrnehmen, wie wir es tun.
Und, wenn wir richtig crazy gehen, dann kommunizieren alle Systeme mit dem ähnlichen Prinzip, aber das wird ein anderer Artikel.
Grundsätzlich bleibt: Wir bauen alles auf und über unsere Kommunikation auf: Selbstbild, Beziehungen, Politik, Gesellschaft. Wir überlassen sie den Lautesten, den Oberflächlichsten, den „Anwendern“. Dabei ist sie unser zentrales Organ für Zusammenleben – so selbstverständlich wie Atmen, so verletzlich wie unser Selbstwert und so entscheidend wie unser Immunsystem.
1. Selbstwert im Gespräch
Wir bringen in jedes Gespräch unser Selbstwertgefühl mit. Ob wir wollen oder nicht. Als Kinder lernen wir früh: Bitte und Danke, brav sein zu Erwachsenen, „Jetzt sei still“. Vieles, was unser Bauch uns meldet („Ich will nicht mit diesem Erwachsenen reden!“), wird überdeckt. Später geben wir Geld für Coachings aus, um wieder „authentisch“ zu sprechen. Willkommen im kapitalistischen Circle of Life.
Um seinen Selbstwert auf der falschen Position einzusetzen, braucht es in diesem Spiel noch nicht mal einen anderen. Wir sind uns selbst der beste Kommunikationspartner: Wir reden ständig mit uns. Beim Zähneputzen, im Bett, in der U-Bahn. „Argh, ich bin so blöd“ oder „Alles gut, das krieg’ ich hin.“ Diese inneren Monologe prägen unser Leben mindestens so stark wie die äußeren.
Wenn Du jetzt gedanklich deine Glaubenssätze durchgehst, dann hast Du das Spiel verstanden!
Albert Ellis sprach von irrationalen Glaubenssätzen („Ich muss perfekt sein!“). Psychologen wie Ethan Kross zeigen: Schon kleine Veränderungen im inneren Dialog – z. B. in der dritten Person zu sich selbst sprechen („Du schaffst das“) – senken Stresslevel und erhöhen Problemlösungskraft (Kross et al., 2014).
Kommunikation, auch mit sich selbst, ist also immer auch Selbstprogrammierung.
Neurofakt am Rande: Soziale Zurückweisung aktiviert die gleichen Hirnareale wie körperlicher Schmerz (Eisenberger & Lieberman 2004). Kein Wunder also, dass wir uns lieber fügen, als riskieren, aus der Gruppe zu fliegen.
2. Information vs. Beziehung
Eigentlich kommunizieren wir immer mit zwei Zielen: Wir tauschen Informationen aus. Und wir verhandeln Beziehungen. Oft gleichzeitig.
Und genau hier knüpft das berühmte Harvard-Prinzip an: In Getting to Yes (Fisher, Ury & Patton, 1981) wird unterschieden zwischen Positionen und Interessen.
Positionen sind die klaren Ansagen – „Wir investieren in die Zukunft!“. Interessen sind das, was wirklich dahintersteckt – vielleicht schlicht die Angst, Kontrolle zu verlieren.
Und genau da wird’s spannend: Denn was ist ein Interesse anderes als Exformation? Tor Nørretranders nannte so das Unsichtbare einer Botschaft (The User Illusion, 1991) – das, was weggelassen, vorausgesetzt, zwischen den Zeilen mitschwingt. Kommunikation ist das Spiel mit dem Unsichtbaren – und genaudarin liegt ihre Kraft.
3. Das Tor zur zu meiner Welt
Es ist faszinierend – und paradox –, aber wahr: Jedes Wort weckt bei jedem ein anderes Bild, eine andere Stimmung, einen anderen Sinn, ein anderes Narrativ. „Hund“ – der eine denkt an die besten Spiele im Park, der nächste an einen schmutzigen Vierbeiner, und jene Person wieder sucht lyrisch die Spur des wilden Wolfs in ihrem Innern. Der Grund: Wörter sind keine festen Etiketten. Sie öffnen neuronale Pfade, Erinnerungsräume, Gefühle – die bei jedem Menschen einzigartig belegt sind.
Kognitionsforscher Julian Pearson und Kolleg*innen haben gezeigt, dass mentale Bilder im Gehirn visuell verarbeitet werden – oft sogar schon in den frühesten visuellen Arealen, etwa V1. Und das unabhängig davon, ob wir tatsächlich sehen oder nur an etwas denken. Gedankenbilder sind also ähnlich echt wie das Wahrnehmen selbst.
Studien zur Imageability – der Leichtigkeit, mit der ein Wort eine mentale Vorstellung weckt – zeigen außerdem, dass gerade Wörter mit starker Bildkraft (z. B. „Rose“, „Wasserfall“) besonders früh gelernt werden und unterschiedlich starke innere Bilder auslösen können.
Spannend dazu: Der Psychologe P. Mondal argumentiert, dass es nicht die Sprache selbst ist, die Denkstile verursacht – es sind die individuellen mentalen Signaturen, die Wörter auslösen und so unser Denken formen. Das gilt sogar bei Menschen, die mehrere Sprachen sprechen – je nach Sprache kann dasselbe Konzept eine andere Gedankenkurve anstoßen.
Dennoch tendieren wir dazu, Begriffe wie „Zuhause“ oder „Liebe“ für universell verständlich zu halten – dabei sind unsere mentalen Bilder davon so individuell wie unsere Persönlichkeit. Sprache wirkt wie ein Kaleidoskop: dieselben Buchstaben, aber innen drin ein ganz anderer, bunter Kosmos.
4. Kontext stiftet Bedeutung: Vom Frame zur Welt und in den Frame
Kontext klingt wie Hintergrundmusik – nett, aber austauschbar. In Wirklichkeit ist er die Partitur. Das Wort selbst verrät es schon: con-texere heißt „mit-weben“. Kontext ist das Gewebe, in das jedes Wort eingespannt ist. Ohne dieses Mit-Text entsteht keine Bedeutung.
Wittgenstein brachte es 1953 auf die einfachste Formel: „Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.“ Nehmen wir „okay“. Alle Buchstaben sitzen. Aber ob dieses „okay“ Zustimmung, Abwehr oder die Vorstufe zum Beziehungsdrama ist, entscheidet nicht die Orthografie, sondern die Situation. Ein Satz lebt nicht im Wörterbuch, sondern in der Szene, in der er gesprochen wird.
Ferdinand de Saussure hat noch eins draufgesetzt: Das Verhältnis zwischen Wortform (signifiant) und Bedeutung (signifié) ist arbiträr – also willkürlich (Cours de linguistique générale, 1916). „Baum“ könnte „Tisch“ heißen, wenn wir uns nur darauf einigen. Und genau dieses Einverständnis macht sie so kraftvoll – und so anfällig für Verschiebungen.
Und genau hier beginnt dann das große Spiel der Frames. Frames sind mentale Deutungsrahmen, da wo das einzelne Bild automatisch zum Film wird. Manchmal vergessen wir, dass jeder Filmidee auch immer ein Genre unterliegt, was öfter mal das Re-Framing auf den Plan ruft. Aus „Scheitern“ wird „Erfahrung“, aus „Trennung“ vielleicht „Neustart“. Klingt kitschig, ist aber ein Ansatz.
Politik und Werbung dagegen spielen oft ein härteres Spiel: Ent-Framing (Verschiebung). Da wird ein Wort nicht nur anders beleuchtet, sondern entkernt und mit etwas völlig Neuem gefüllt. „Heimat“ etwa wird aus der warmen Ecke der Kindheit gezogen und als politischer Grenzpfosten missbraucht. Das ist Propaganda in ihrer elegantesten Form: Sie stiehlt uns vertraute Resonanzen, um sie gegen uns zu wenden.
Das Gefährliche daran: Je selbstverständlicher wir annehmen, dass „Liebe“, „Heimat“ oder „Freiheit“ für alle dasselbe heißen, desto leichter lassen sich die Frames verschieben. Sprache ist kein stabiler Baukasten, sondern ein Spielfeld. Wer den Kontext setzt, setzt die Bedeutung. Und wer die Bedeutung setzt, hat Macht über das Gespräch – ob am Esstisch oder im Wahlkampf.
5. KI – Von der Syntax in die Semantik
Es ist wirklich bemerkenswert, dass wir fast alle eine Zweitsprache in der Schule lernen, aber kaum etwas über Sprache selbst wissen. Wir büffeln Vokabeln und Grammatik, drillen Syntax – also welche Wörter wie in einem Satz stehen dürfen. Damit’s nicht so klingt wie bei Yoda.
Technisch sind wir längst weiter: mitten in der Semantik. Und wer bei Talkshows oder in Spiegel-Bestsellern über „Sprachverfall“ klagt, übersieht: Sprache verdirbt nicht. Sie entwickelt sich – ständig. Die Frage ist nur: in welche Richtung? Und das hängt weniger von Grammatikheften ab als von unserem Lebensradius.
Die Syntax kann richtig sein, aber unsinnig:
„Farblose grüne Ideen schlafen wütend.“ (Noam Chomsky, 1957)
Die Syntax stimmt, aber die Bedeutung kollabiert.
Semantik sucht Zusammenhänge und Kontexte. Ein Satz, eine Aussage soll Sinn machen, Bedeutung tragen. KI kann genau das – in unfassbarer Geschwindigkeit, oft weniger anstrengend und schneller, als wir beim Zuhören am Abendbrottisch. Diese Gespräche, bei denen man dann doch nicht kapiert, warum die Geschichte von Gabi’s neuer Tapete schon wieder erzählt wird.
Und genau da liegt der Knackpunkt: Wir haben im syntaktischen, linearen Miteinander bereits vergessen, dass wir mehr sind als Struktur und reduzieren in der faszinierenden Ohnmacht der schnellen Antworten, unsere Bedeutungen. Es ist ein bisschen so, als hätten wir fast jede Sportstunde geschwänzt, und nun haben wir einen Freipass für den Startplatz bei den Olympischen Spielen.
KI ist Teil unserer Kommunikation und wird es auch bleiben. Aber, bevor wir uns im nächsten Stuhlkreis mit Schlagwörtern wie Re-Framing beruhigen, wäre ein Ausflug in die Linguistik die bessere Wahl.
6. Von der gesicherten wenn-dann-Zukunft und fatalen Annahmen
Um die sichere Zukunft vorauszusagen, schaffen wir uns Kausalitäten. Wir basteln wenn-dann-Geschichten: Wenn X, dann Y. Und wir folgen diesen inneren Drehbüchern so treu wie einem Navi, das kein Update mehr geladen hat.
Dass wir vor einem Säbelzahntiger lieber direkt wegrennen statt noch schnell zu diskutieren, ob Flucht wirklich Sinn macht, hat uns die Evolution fest verdrahtet. Genauso tief verdrahtet wirkt heute die Annahme: Der Chef, der Präsident, der Kapitän – die müssen doch die Klügsten im Raum sein.
Willkommen im Reich der Prämissen. Prämissen sind Annahmen (Artikel kommt noch ;)), die wir wie Legosteine aneinanderstecken, bis sie stabil wirken. Zwei Sorten nerven uns besonders: die kategorische (Alle Präsidenten sind schlau) und die konditionale (Wenn ich Harmonie suche, bin ich ein guter Mensch).
Über die Zeit werden solche Prämissen brüchig. Aber wir halten daran fest wie Kinder am Bein der Mutter vor dem Kindergarten: laut, verzweifelt, unbeirrbar – und machen die Annahmen irgendwie passend.
Gehen wir also kategorisch davon aus, dass alle Präsidenten die schlausten Köpfe sein müssen (wie sollte man auch sonst ganz nach oben kommen), verlieren wir unsere Selbstwirksamkeit und legen – all-in – unseren Selbstwert auf den Tisch. Wenn sich dann noch die konditionale Prämisse dazu gesellt (Pssst!! Wir wollen ja gute Menschen sein), dann haben wir nicht nur die grundlegenden Spielarten der Kommunikation nicht verstanden, sondern halten Führungsämter mit Inkompetenz und Egos besetzt. Ups.
Wir alle finden uns auf dem Spielplatz der Kommunikation wieder und wir lieben die sichere, starke Rolle: Eltern, die ihre Kinder maßregeln, aber beim Chef wortlos den Druck aushalten. Lehrer, Coaches, Trainer, die große Reden über Selbstwirksamkeit schwingen – um sich danach mit der zweiten Flasche Wein in den Schlaf zu wiegen.
Zur lebendigen Kommunikation gehört immer auch der Spiegel: sich selbst im Miteinander sehen – und sich fragen, welche Geschichten wir da gerade nachsprechen, ob unsere Prämissen noch stimmen.
7. Körper – Sprache
Blättert man durch die Lehrbücher über Kommunikation, springt einem Paul Watzlawick’s Satz entgegen wie das elfte Gebot: “Man kann nicht nicht kommunizieren.”
Rhetorik ist lernbar und Wortwitz ebenso, dass der Körper und die Kommunikation aber eine existenzielle Beziehung haben, sollte nicht ignoriert werden.
Ohne unseren Körper kommen wir nicht durch das irdische Leben. Kein Ich, kein Selbst, kein Du, kein Wir, kein Miteinander. Wir besitzen krasse Regulationsachsen, die innen und außen, das Miteinander immer wieder abchecken, kompensieren, regulieren und orchestrieren – Ein Wunderwerk!!
Schlechte Kommunikation tut weh – und zwar nicht nur metaphorisch. Das Gehirn macht da keinen Unterschied: Abwertung oder Ignoranz aktivieren dieselben Schmerzzentren wie ein Schlag aufs Schienbein (Eisenberger & Lieberman 2004). Dabei ist es nicht ein Schlag, der das Scheinbein chronisch schmerzen erzeugt, sondern die kleinen Wörter und Gesten, die immer wieder unsere Position anknabbern – winzige Sprachakte (Austin 1962), die wie Mikronadeln wirken. Wenn auf ein “Sei leise”, die Eltern dann selbst rumschreien, gehen Körper und Sprache nicht Hand in Hand. Hallo Trauma. Diese grundlegende Kunst der Kommunikation hinterlässt dann eine Semantik, die sich nicht so einfach wegmeditieren lässt.
Letztlich suchen wir in unserer Kommunikation, im miteinander Sprechen, nicht Verständnis, sondern Validierung! Wir wollen wissen, dass unsere Existenz validiert ist – für das Ich und die Gemeinschaft. Ohne Validierung gehen deine Systeme Survival, dann feuert alles in Alarm! Und, unser Körper ist hier ein guter Zeuge!
Sprache ist Handeln, und der Körper rechnet mit. Das Gute daran: Gute Kommunikation wirkt wie ein Reset-Knopf fürs Nervensystem, mit Oxytocin frei Haus (Übrigens auch im Monolog:)).
Take away
Am Ende ist es vielleicht gar nicht so kompliziert. Kommunikation ist nicht nur das, was wir tun, wenn wir reden oder schreiben. Sie ist das, worin wir wohnen. Jedes „Na, alles gut?“ im Treppenhaus, jedes „Schon wieder?“ im Büro, jedes „Ich Idiot“ vorm Badezimmerspiegel baut an dieser Wohnung mit. Mal reißen wir tragende Wände ein, mal öffnen wir Fenster, mal ziehen wir unbemerkt Vorhänge zu.
Und genau deshalb lohnt es sich, ein bisschen mehr über Sprache und Kommunikation zu wissen. Nicht im Sinne von „noch ein Rhetorikseminar“. Linguistik ist nichts Abgehobenes – sie erklärt uns, warum Frames wirken, warum Wörter Bilder auslösen, warum wir an unserer Heilungsgeschichte festkleben, warum KI Bedeutungen braucht, und warum ein „Danke“ manchmal mehr Stress löst als jede Atemübung.
Kommunikation ist kein Luxus, kein Add-on. Sie ist Lebensqualität. Je besser wir verstehen, wie sie funktioniert, desto weniger überlassen wir sie den Gatekeepern – und desto mehr können wir selbst gestalten. Kommunikation ist unser stärkstes Bindemittel, nicht nur aus Vokabeln und Strukturen, sondern eben Selbstwert, Exformation, Positionsabsicherung, Vertrauen, Wirksamkeit und Gesundheit. Ständig in Verbindung zwischen innen und außen. Und das ist im Grunde ziemlich schön: dass wir mit nichts weiter als unseren Worten unser Zusammenleben jeden Tag ein kleines Stück heller machen können.