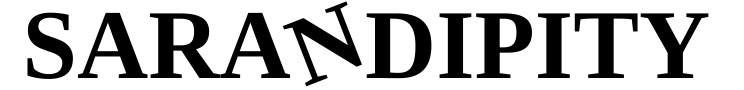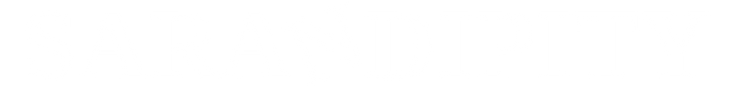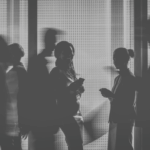Er trat aus dem Seiteneingang der Seniorenresidenz, die um diese Uhrzeit bereits hinter ihren Fenstern zur Ruhe kam, als hätte sich die Welt für ein paar Stunden in Watte gewickelt. Die Hände in den Taschen vergraben, spürte er das Nachglühen der Mühe in seinen Schultern. Der Tag hatte wieder einmal mit dem Waschlappen begonnen und mit einem Händedruck geendet, der mehr bedeutete als jedes freundlich dahingesagte Wort.
Draußen roch es nach feuchtem Herbstlaub und dem Rest von Tageshitze, die sich zwischen den Pflastersteinen staute. Sein Name war Karim, und sein Leben war gewebt aus Geschichten, die er selten erzählte. Der Boden unter seinen Füßen war nicht der seiner Kindheit, doch er ging darauf, als könne er mit jedem Schritt etwas von seiner Würde in die Welt hineintragen.
In der Residenz mochte man seine Hände. Man sagte, sie seien sanft, obwohl sie kräftig zupackten. Seine Art, jemanden zu waschen, das Kissen neu zu formen, die Lippen mit einem feuchten Tupfer zu benetzen – all das war keine Technik, sondern eine Geste des Zuhörens. Er hatte das gelernt, lange bevor er es sich selbst erklären konnte.
Einmal hatte ihm Frau Seifert – eine der wenigen, deren Alter die Welt nicht klein gemacht hatte – gesagt, dass er etwas in sich trage, das andere vergessen hätten: ein Wissen darum, dass niemand geringer wird durch Schwäche. Es war ein Satz, den er oft in sich drehte, wie einen Stein, dessen Oberfläche immer wieder neue Muster freigab, je nachdem, wie das Licht darauf fiel.
Auf dem Weg zur S-Bahn hielt er kurz inne, als eine Gruppe junger Männer laut lachend an ihm vorbeizog. Einer spuckte in seine Richtung. Der andere rief ein Wort, das nicht für ihn gedacht war, und doch wie ein Keil in seine Brust fuhr. Es kam leicht daher, wie ein Scherz, der auf halbem Weg verrottet war, bevor er überhaupt angekommen war.
Er hob den Kopf, sah dem Jungen nicht hinterher, sondern in die Tiefe des Moments. Die Augen blickten nicht zurück, suchten keine Auseinandersetzung. Nur das Zittern in seinem rechten Handgelenk verriet, dass etwas an diesem Tag nicht mehr in die gleiche Form zurückfinden würde.
Im Zug saß er später neben einer Frau mit feinem Mantel. Ihre Haltung wirkte, als sei sie gewöhnt, sich Räume zu nehmen. Sie rückte kaum merklich zur Seite, als er sich setzte, und schlug die Beine übereinander, wobei das Parfum in der Luft stand, als hätte es sich selbst zu wichtig genommen. Sie grummelte etwas wie “er denkt, er kann sich hier alles erlauben”. Ihre restliche Stille war kein Schweigen, sondern eine Art der Ansage. Eine, die mit Worten nichts zu tun hatte, aber mit Bedeutung überladen war. Er kannte diese Momente. Sie waren wie Risse im Putz, unscheinbar und doch voller Botschaft.
Er stellte sich vor, wie sie reagieren würde, wüsste sie, dass er eben jenen Mann gewaschen hatte, der einst Bürgermeister gewesen war. Dass seine Hände jene waren, die den Körper eines Professors gehalten hatten, als dieser die Orientierung verlor und nur noch in Gedichten sprach. Dass er jeden Tag Verantwortung übernahm für das, was andere nicht einmal benennen konnten, ohne es in Abstand zu verpacken.
Doch er sagte nichts. Stattdessen richtete er seinen Blick auf das Fenster, das die dunkle Landschaft an sich vorbeiziehen ließ. Dort draußen lagen Felder, Dörfer, vereinzelte Laternen, deren Licht wie Erinnerung in das Jetzt fiel. Er ließ die Gedanken gleiten, suchte keine Lösung, sondern eine Form der Gegenwart, in der er sich tragen konnte.
Es gehörte jetzt zu Karim’s Leben, den Menschen ihre Geschichte abzunehmen. Er war da, wenn ihre Schuld, ihr Scham, ihre Liebe und die verflossenen Wünsche nach Anerkennung suchten. Oft erzählten sie von ihren Kindern, der Familie, den Liebhabern und den Dingen, die sie im Leben geschafft haben – oft blieb der Stuhl neben dem Bett leer.
In seinen Träumen sprach er oft mit seinem Vater. Der war früher Lehrer gewesen, ein ruhiger Mann mit wenigen Worten und tiefem Blick. „Man erkennt einen Menschen nicht an seiner Sprache, sondern daran, wie er mit Schwäche umgeht“, hatte er einmal gesagt, als Karim noch ein Kind gewesen war. Dieser Satz war geblieben. Heute verstand er ihn tiefer. In den Korridoren der Residenz, wo Atemzüge langsamer wurden, wo jeder Tag sich anfühlte wie eine Verlängerung des Daseins, dort wuchs in ihm das Verständnis, dass Stärke keine Form, sondern ein Zustand war – einer, der sich nicht messen ließ.
An der Endstation stieg er aus. Die Stadt wirkte ruhiger hier, fast verschlafen, als hätte sie sich vom eigenen Tempo zurückgezogen. In einem kleinen Restaurant holte er sich einen Teller Suppe. Der Kellner fragte ihn dreimal, was er wolle, als hätte er das Wort „Linsensuppe“ nicht hören können oder nicht hören wollen. Eine Gruppe am Nebentisch kicherte, und einer rief: „Na, habt ihr keine eigenen Löffel in eurem Land?“
Karim drehte sich nicht um. Er wusste, wie man mit Blicken schlägt. Wie man mit Fragen, die keine Antworten suchten, eine ganze Identität zu Karikatur machen konnte. Die Suppe war heiß, sie schmeckte nach Zuhause, obwohl sie es nicht war.
Der ältere Herr am Nebentisch, grauhaarig, mit brüchiger Stimme, sagte später zu ihm: „Sie arbeiten doch im Pflegeheim in der Kaiserstraße? Meine Schwester war dort. Sie hat oft von Ihnen gesprochen.“ Karim nickte, legte die Hand auf sein Herz. „Ich erinnere mich an sie. Eine starke Frau.“ Der Mann sah ihn an, lange, mit einem Ausdruck, der aus einer anderen Zeit kam, als Begegnungen noch Gewicht hatten. „Sie mochte Ihre Stimme. Hat gesagt, bei Ihnen hatte sie weniger Angst vorm Schlafen.“
Karim lächelte. In ihm stieg etwas auf, das schwer zu fassen war. Vielleicht so etwas wie Trost, vielleicht Würde. Vielleicht war es das, was blieb, wenn alle anderen Kategorien versagten.
Auf dem Heimweg ging er langsam. Die Straßenlaternen warfen Schatten, die wie Geschichten über den Asphalt glitten. In seinem Kopf bewegten sich die Bilder des Tages wie auf einer alten Filmrolle. Die Frau im Zug. Der Junge mit dem Spott. Die Schwester des alten Mannes. Seine Hände, die wuschen, hielten, stützten. Die Stimme, die beruhigte. Der Blick, der versuchte zu verstehen.
Er dachte daran, wie viele dieser Menschen sich selbst für bedeutender hielten, weil sie Bücher schrieben oder Zahlen analysierten oder Projekte managten, als könne man Leben in Excel-Zellen fassen. Und doch, wenn es dunkel wurde, wenn Körper versagten, wenn der letzte Weg sich auftat, da wollten sie Hände wie seine. Keine Debatte. Kein Konzept. Nur Halt.
In seinem kleinen Zimmer, das er sich mit einem anderen Pfleger teilte, stellte er den Rucksack ab, zog die Schuhe aus und wusch sich die Hände. Langsam, wie in einem Ritual. Dann setzte er sich ans Fenster, öffnete die Vorhänge und ließ den Blick in die Nacht gleiten.
„Du musst dir dein Leben selber zusammenbauen“, hatte seine Mutter gesagt, als er in das neue Land aufbrach. Sie hatte ihm ein kleines Medaillon mitgegeben. Darin lag kein Foto, sondern ein Samenkorn, eingewickelt in ein Stück Papier mit einem Wort darauf: Geduld.
Er hatte es nie eingepflanzt. Vielleicht, weil er nicht wusste, wo sein Boden war. Vielleicht, weil er glaubte, das Wachsen müsse in ihm selbst geschehen.
Er dachte oft darüber nach, was Heimat bedeutete. Vielleicht war es nicht ein Ort, sondern die Art, wie man gehalten wurde – oder selbst hielt. Vielleicht war sie kein Land, sondern ein Zustand, in dem man sich gesehen wusste, auch ohne Worte.
Draußen fiel Regen, leise und regelmäßig, wie ein Taktgeber für das, was morgen wieder beginnen würde. Ein neuer Tag, neue Stimmen, neue Blicke. Und dennoch die gleiche Arbeit, die gleiche Würde, das gleiche Versprechen an sich selbst: nicht zu entmenschlichen, was schwach erschien. Nicht zu vergessen, dass jeder Mensch einmal das Gesicht eines Kindes getragen hatte.
Karim legte sich hin. Seine Schultern sanken in die Matratze. Der Tag fiel von ihm ab, langsam, Schicht für Schicht. In seinem Inneren blieb ein leiser Satz zurück: Ich trage Menschen, wenn sie sich selbst nicht mehr tragen können. Und das bleibt, auch wenn sie meinen Namen vergessen haben.