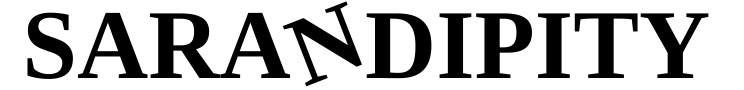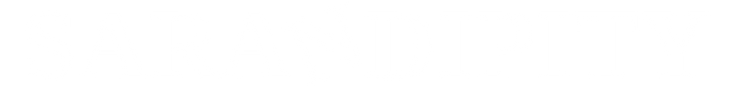Er hatte diese Art, die wie Neugier wirkte. Ein bisschen zu wach, ein bisschen zu schnell, aber ich wollte glauben, dass er wirklich wissen wollte, wer ich bin. Er fragte mich beim ersten Date, ob ich Kinder haben wolle. Seine Fragen wirkten aufrichtig, ein bisschen unbeholfen, aber genau das machte sie echt. Ich nahm es ernst. Und ich, die sonst so oft erklärte, beschrieb, übersetzte – ich ließ mich darauf ein. Auf ihn. Auf das, was da möglich schien. Ich dachte, mit über vierzig fragt man sowas nicht aus Langeweile.
Er spielte mit großen Worten. Mit Zukunft. Mit Intimität. Nicht mit dem Körper, sondern mit der Vorstellung davon, Nähe zu schaffen.
Er sagte mir oft, wie ich sei. Stark. Klar. Schnell. So, als würde ich ihm vorkommen wie ein Sturm, den er bändigen müsste. Ich lachte, manchmal, weil ich dachte, es sei charmant. Manchmal auch, weil ich nicht wusste, wie ich antworten soll, wenn jemand dein Innerstes schon kennt, bevor du überhaupt etwas sagen konntest.
„Hast Du auch mal so richtig ruhige Tage?“ hatte er einmal gefragt, und ich erinnerte mich an seinen Blick dabei – halb liebevoll, halb müde. Ich lächelte. Damals noch. Weil ich dachte, er meine mich wirklich. Heute weiß ich, er meinte sich.
Er war erschöpft davon, sich neben mir klein zu fühlen. Er wollte, dass ich stiller werde, damit seine eigene Lautlosigkeit nicht auffiel.
Ich begriff nicht gleich, wie sehr er sich in mir gespiegelt hatte. Und wie sehr er dieses Bild gebrauchte.
Wir waren nicht ständig zusammen, auch wenn es sich genau so anfühlte. Als hätten wir den Rhythmus des Anderen bereits in uns aufgenommen. Ich wollte unbedingt an unsere Verbundenheit glauben. Und ich war gut darin!
Die Abende, die wir getrennt verbrachten, betrank er sich und kiffte bis er irgendwo einschlief. In regelmäßigen Abständen kamen auch seine Freunde zum Koksen vorbei, er nannte sie selbstverständlich “Männerabende”. Er lud Menschen zu sich ein, die ihn feierten, mit denen er sich verlor, in Gesprächen, die nichts trugen. Als müsste er seinen Mangel wässern, als sei das Loch in ihm eine Pflanze, die mehr Dunkelheit braucht, nicht Licht.
Dass das keine Ausnahme war, sondern sein Lifestyle, verstand ich erst später. Wenn er morgens kaum aufstehen konnte, er in Weinkrämpfen vor mir saß oder böse Worte fand, um zu testen, ob ich gehen würde. Der Wind drehte sich immer ziemlich schnell. Was morgens wie ein Zyklon wirbelte, war mittags bereits ein zufriedenes Lächeln – weitergeht’s.
Als wir zum ersten Mal ein Wochenende zusammen verbrachten, brachte er Nikotinpflaster mit. Ein kleines Detail, fast beiläufig, aber ich bemerkte es. Er wollte aufhören, „für mich“. So sagte er es, und ich wollte ihm glauben. Er erzählte mir, wie stark ihn seine Sucht belastete und auch, dass Ängste dazukämen – Dieser neue Raum, der sich hier öfnete, ich wollte da rein!
Er sprach viel von seiner Kindheit. Von der leidenden Mutter, dem stummen Schmerz, von einer Ex, die ihn „in den Wahnsinn getrieben“ habe, er einfach nicht mehr mit ihr geschlafen habe, “die Vibes waren mies”. Alles in hoher Geschwindigkeit, als könnte er den Schmerz hinter sich lassen, indem er ihn einfach schneller abspielte. Fast forward. Kein Halten. Kein Spüren. Nur eine Wiederholung, die ihn berechtigte.
Als er den gemeinsamen Frühstückstisch ohne Worte verließ, erklärte er fast beiläufig:
„Ich habe endlich verstanden, dass es okay ist, anderen wehzutun, damit es mir besser geht.“ Er ging.
Ich fror. Ich spürte, dass ich diesen Moment nachspüren würde.
Ich wusste in diesem Moment, dass er über Grenzen sprach – nicht um sie zu achten, sondern um sie zu einer Kriegsfront zu machen, einer Auseinandersetzung, bei der er sich spüren kann.
Er hatte nicht nur sich zu einer Funktion gemacht, zu einem Opfer, das Erlösung sucht. Er hatte auch sein Trauma funktionalisiert. Es war nicht mehr Schmerz, es war Währung.
Und ich? Ich hatte geglaubt, wir könnten gemeinsam wachsen. Ich hatte ihn eingeladen, nicht zu mir, sondern in etwas Tieferes. Ich wollte eine Beziehung, die sich wertschätzend zeigt, liebevoll, aufrichtig und hatte die falschen Mittel. Ich verließ die aufregende Seite der Hoffnung.
Er traf mich da, wo ich am wenigsten Erfahrung hatte: nährende Intimität.
Ich brachte eine Offenheit mit, die sich nicht an Bedingungen band. Ich dachte, er spürt das. Ich dachte, er könnte es halten. Ich hatte eine Erinnerungsnotiz an meinem Spiegel: Sei nicht zu schnell.
Ich mache seine Beschränkungen zu meiner Definition. Ich suchte eine Logik.
Sanfte Wünsche, leise Bitten – sie provozierten ihn. Als müsse man etwas Grobes in ihm berühren, damit er spürt, dass er noch lebt. Er spielte Träume nach, ohne sie zu tragen.
Und ich stand da, mit meinem offenen Herz, meinen echten Fragen, meinem Wunsch, gesehen zu werden – und erkannte, dass ich längst Teil eines Spiels war, dessen Regeln ich nie verstanden hatte.
Ich habe nicht alles durchschaut, als es passierte. Ich spürte nur, dass etwas nicht stimmt. Dass er mich nicht wirklich meint, wenn er sagt: „Ich will dich.“
Er wollte etwas, das ihn heilt, ihn hält, ihn ganz macht.
Aber nicht, weil er bereit war, ganz zu sein –
sondern weil er glaubte, er dürfe sich nehmen, was ihm fehlt.
Ich wollte kein Pflaster auf seine Wunden sein.
Ich wollte keine Projektionsfläche sein für seine Selbsterlösung.
Ich wollte nicht die Frau sein, die „stark genug“ ist, um auch das noch auszuhalten.
Ich wollte einfach ich sein dürfen.
Er war so geübt darin, sich nicht zu spüren, dass er es gar nicht bemerkte, wenn er andere mit hinunterzog.
Ich ging.
Nicht laut. Nicht dramatisch.
Ich ging, weil ich noch Hoffnung hatte – für mich.
Bevor ich seine Tür schloß, sah ich ein Nikotinpflaster auf der Kommode. Unbenutzt.
Vielleicht war das der ehrlichste Moment des ganzen Wochenendes.
Vielleicht war es der einzige.