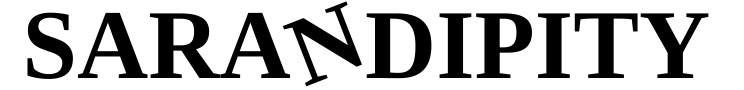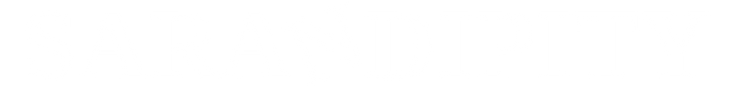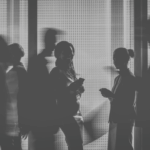Man kann durch sein Leben gehen, als wäre es ein Flussdelta. Manche Arme führen schnell und geradlinig ins offene Meer, andere mäandern, bleiben lange im Land, um dann vielleicht doch zu versickern. Drei davon sind besonders einflussreich: Wollen, Mögen und Können. Sie entspringen aus ähnlichen Quellen, fließen manchmal zusammen, doch ihr Wasser schmeckt verschieden. Wer lernen will, sein Boot zu steuern, muss erkennen, in welchem dieser Gewässer er gerade unterwegs ist. Denn jede Strömung wird in unserem Nervensystem anders erzeugt, anders gelenkt und anders erlebt.
Alle drei Strömungen haben ihre eigene innere Stimme und eigenen Rhythmus. Das Wollen pusht einen fokussiert zu einem Ziel. Das Können meldet sich als Versicherung und Beweis dafür, dass wir für gewisse Dinge Kontrolle haben. Das Mögen ist im Moment, keine to-do Liste, keine Rolle, einfach nur im Genuß, hier und jetzt. Es vertritt die ur-eigene Persönlichkeit. Es ist der Fingerabdruck des Antriebs.
In der Balance dieser Stimmen liegt die Kunst, ein Leben zu führen, das nicht nur effizient, sondern auch erfüllend ist.
Wollen – die Maschine
Was wir durch unseren Willen alles erreichen können, ist unfassbar. Im Spitzensport, in der Politik, beim Lernen, bei der Erziehung oder dem morgendlichen Schwung. Das Wollen ist der Antrieb, der den Rahmen für das Vorankommen setzt. Es ist wie ein Navigationsgerät, das jedes lohnende Ziel aufleuchten lässt.
Im Gehirn gibt es eine Art Hauptstraße für Motivation, dem mesokortikolimbischen System. Sie beginnt in einer kleinen Region tief im Kopf, dem ventralen Tegmentum. Hier entstehen die „Startfunken“, die uns sagen: Los, das ist spannend!. Von dort geht es weiter zum Nucleus accumbens – er wirkt wie ein innerer Scheinwerfer, ein Spotlight, der ein Ziel anstrahlt, bis es hell leuchtet. Am Ende landet das Signal im präfrontalen Kortex, ganz vorne hinter der Stirn. Dort sitzt so etwas wie ein Planungsbüro: Hier wird eine Entscheidung getroffen und nicht immer nüchtern geprüft. Bei dieser Entscheidung wird nach Logik und Narrativ gehandelt. Oft arbeitet er im Halbschatten, unbewusst, und strickt eine passende Geschichte um eine Entscheidung, die längst gefallen ist. Man glaubt, bewusst gewählt zu haben, doch in Wahrheit hat man nur den Kommentar zu einem schon geschriebenen Kapitel geliefert.
So arbeitet dieser Weg wie eine Brücke: Er verbindet die älteren Teile unseres Gehirns, die für Instinkt und schnelle Reaktionen zuständig sind, mit den jüngeren Bereichen, die planen und abwägen können.
In diesem Netz zündet Dopamin. Nicht als „Glückshormon“, wie es populär verkürzt wird, sondern als Signal, dass etwas Bedeutung hat – incentive salience nennen Berridge und Robinson (2003) diese Funktion. Entgegen dem alten Mythos ist Dopamin nicht das „Glückshormon“. Es sorgt nicht dafür, dass wir uns glücklich fühlen, sondern dass wir uns auf etwas zubewegen wollen. Es verstärkt die Aufmerksamkeit für Reize, die unser Gehirn als bedeutungsvoll markiert – das genau ist die incentive salience (Berridge & Robinson, 2003). Deshalb kann uns manchmal ein plötzlicher Funke so sehr in Bewegung bringen – lange bevor wir bewusst entschieden haben, ob wir überhaupt loslaufen wollen.
Wenn das Wollen-System dauerhaft auf Hochtouren läuft, steigt die Dopaminaktivität im mesolimbischen Pfad. Kurzfristig bringt das Schwung, langfristig aber gewöhnt sich das System an den Reiz. Desensibilisierung nennen die Fachleute das: Es braucht immer mehr Input, um denselben Antrieb zu spüren. Das ist wie bei einem Film, den man schon fünfmal gesehen hat – beim ersten Mal war er aufregend, beim fünften läuft er nur noch nebenher.
Franca Parianen beschreibt in Hormongesteuert ist immerhin selbstbestimmt, dass Hormone wie Testosteron oder Cortisol den „Wollens-Motor“ stärker oder schwächer laufen lassen. Testosteron kann zum Beispiel den Mut erhöhen, ein Ziel zu verfolgen, Cortisol kann den Blick auf Bedrohungen schärfen und dadurch das Wollen auf Sicherheitsverhalten lenken.
Wollen orientiert sich stark am Außen: an Dingen, die erreichbar sind und Anerkennung bringen. Es ist also kulturell und sozial geprägt. Es ist kraftvoll – aber ohne die anderen Strömungen kann es zu einem ständigen „Hinterherjagen“.
Mögen – das innere Aufleuchten
Mögen ist das stille, unmittelbare Gefallen am Tun selbst. Es ist wie der Moment, in dem man eine süße Frucht isst und der Geschmack selbst Freude auslöst – unabhängig davon, ob noch mehr davon kommt.
Neurobiologisch steckt Mögen in kleinen „Freudenzentren“ des Gehirns, den sogenannten hedonischen Hotspots. Diese liegen zum Beispiel in einem Teil des
(shell), im ventralen Pallidum, im orbitofrontalen Kortex und in der Insula (Berridge & Kringelbach, 2015). Diese Hotspots nutzen nicht Dopamin, sondern Opioide, Endocannabinoide und GABA – chemische Botenstoffe, die für angenehme Empfindungen, Entspannung und Genuss stehen.
Parianen weist darauf hin, dass Stresshormone wie Cortisol diese Zentren „leiser drehen“ können. Wer unter Dauerstress steht, kann zwar wollen und können, aber das Mögen wird schwächer. So kommt es, dass Tätigkeiten, die früher Freude bereiteten, plötzlich neutral wirken.
Mögen – der persönliche Touch
Das Mögen hingegen hat weniger mit Kursen und Zielen zu tun. Es ist das stille Aufleuchten mitten im Tun, oft in der stillen Introversion. Das Mögen erlebt man in Momenten der Losgelassenheit, der Wertfreiheit und dem Gefühl der Sicherheit, wie ein Floaten – Momente, in denen das Hier und Jetzt selbst genug ist. Diese Freude entsteht in winzigen Inseln im Gehirn, den hedonischen Hotspots. Sie finden sich im Nucleus accumbens (shell), im ventralen Pallidum, im orbitofrontalen Kortex und in der Insula (Berridge & Kringelbach, 2015). Anders als das Wollen, das von Dopamin getrieben wird, lebt das Mögen von endogenen Opioiden, Endocannabinoiden (Sie heißen z. B. Anandamid. Dieses Wort kommt von „Ananda“, dem Sanskrit-Wort für Glückseligkeit) und GABA (hält alles in entspannten Gleichgewischtr und hemmt Nervenerregung, bevor man komplett überreizt. Braucht man übrigens auch zum Durchschlafen). Sie erzeugen nicht das Drängen nach mehr, sondern das satte Empfinden: so, genau so, ist es gut.
Parianen weist darauf hin, dass Stress diese Inseln schnell zum Verstummen bringen kann. Ein erhöhter Cortisolspiegel, wie er bei chronischer Belastung entsteht, dreht den hedonischen Reglern den Ton leiser. Wer will und kann, spürt dann oft trotzdem keine Freude – Tätigkeiten, die früher Wärme auslösten, werden farblos. Es ist, als läge Nebel über dem Fluss.
Wenn das Mögen-Systems zu selten anspringt, zeigt es ein Muster, bei dem es nicht um zu viel Reiz geht, sondern um zu wenig Aktivierung der hedonischen Hotspots. Die Folge ist eine Abflachung der emotionalen Resonanz – eine leise, schleichende Form der Anhedonie. Berridge & Kringelbach (2015) beschreiben das nicht als Drama, sondern als etwas, das den Farbton des gesamten Lebensgefühls verändert, ohne dass man sofort merkt, warum es blasser wirkt.
Können – die gespeicherte Erfahrung
Können schließlich ist das, was wir über Zeit und Wiederholung in unseren Körper und Geist eingeschrieben haben. Jede erlernte Fähigkeit, jeder Handgriff, jedes Muster liegt wie ein Werkzeug im Kasten bereit. Das Wissen, das wir in unserer eigenen Logik immer wieder abrufen, das ist unser Können. Das Können enthält ganz viel Eigenes in der Gemeinschaft. Es ist quasi das Klebemittel, das man einsetzen kann, um seinen Beitrag für das große Ganze zu leisten.
Können hat immer zwei Seiten – und beide sitzen in unterschiedlichen „Abteilungen“ unseres Gehirns. Die erste Abteilung ist für das motorische Können zuständig, also alles, was der Körper kann. Fahrradfahren, tippen, eine Schleife binden. Hier werkeln das Striatum (in den Basalganglien), das Kleinhirn, der motorische Kortex und der präfrontale Kortex Hand in Hand. Mit jedem Üben legen sich kleine „Isolierschichten“ (Myelin) um die Nervenbahnen – wie bei einem gut umwickelten Kabel. Ergebnis: Die Signale flitzen schneller, die Bewegung läuft flüssiger. Dopamin (unser „Hat-geklappt!“-Botenstoff) markiert zusätzlich die Abläufe, die besonders gut funktionieren. Irgendwann übernimmt das Striatum so viel Arbeit, dass der „Chefplaner“ im präfrontalen Kortex fast Pause hat – und wir machen einfach.
Zum anderen gibt es das kognitive Können – die Fähigkeit, Wissen in Handlung zu übersetzen. Hier sind es vor allem der präfrontale Kortex, der Hippocampus, der Parietallappen und die Temporallappen, die zusammenarbeiten. Dopamin verstärkt erfolgreiche Denkstrategien, Acetylcholin bündelt die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche, Noradrenalin hält den Fokus auch unter Druck, und BDNF baut neue Nervenverbindungen auf, wenn wir lernen.
Man könnte sagen: Wissen ist die Seekarte, Können ist das Segeln. Stell dir vor, du hast irgendwo im Kopf eine detaillierte Karte einer Lagune gespeichert. Das allein bringt dich nicht ans Ziel. Erst wenn dein Gehirn all seine schlauen Helfer zusammentrommelt, gleitest du tatsächlich übers Wasser. Der präfrontale Kortex ist der Kapitän, der entscheidet, welchen Kurs du einschlägst. Der Hippocampus ist der Steuermann, der sich erinnert, welche Strömung dich beim letzten Mal schneller vorangebracht hat. Der Parietallappen ist der Navigator, der dir sagt, wann die Flut kippt. Und die Temporallappen sorgen dafür, dass „eine ruhige Bucht“ nicht mit „einer gefährlichen Strömung“ verwechselt wird.
So wird aus einem bloßen Gedanken, einem theoretischen „Ich könnte…“ ein echtes Tun. Wissen, das in Aktion geht, verwandelt sich in Können – und je öfter du diesen Prozess durchläufst, desto selbstverständlicher wird er. Irgendwann musst du nicht mehr nachdenken, du machst es einfach. Genau hier wohnt die Magie des kognitiven Könnens: Es macht den Unterschied zwischen einer Idee und einer gelebten Handlung.
In beiden Formen des Könnens arbeitet das Gehirn mit Belohnungsvorhersage: War eine Handlung oder Strategie erfolgreich, wird der neuronale Weg markiert und durch Wiederholung stabilisiert.
Wolfram Schultz (2015) beschreibt, wie Können aus der Mischung von Erfahrung und Belohnungsvorhersage wächst: Das Gehirn merkt sich, welche Handlungen in der Vergangenheit funktioniert haben, und ruft sie bei ähnlichen Situationen automatisch ab. So entsteht Können – als eine Mischung aus körperlicher Routine und geistiger Handlungsfähigkeit, fest verankert in der Geschichte unseres Nervensystems.
Wer nur im Können verharrt, bleibt oft in einer Kontrollzone (so nenne ich die Komfortzone): ein Bereich, in dem Fähigkeiten reibungslos abgerufen werden, ohne dass echtes Risiko besteht. Die Kontrollzone fühlt sich sicher an und verhindert Fehler. Sie ist aber auch der Ort, an dem kaum noch Neues geschieht. Für Wachstum braucht es daher bewusste Ausflüge hinaus aus dieser Zone, bei denen Wollen und Mögen wieder stärker ins Spiel kommen. Das Gehirn speichert jede Menge hilfreiche Muster – aber auch Strategien, die in einer Mangelsituation entstanden sind. Übermäßige Vorsicht, das ständige Erfüllen fremder Erwartungen, selbstbegrenzende Routinen – all das kann im Striatum genauso zuverlässig abgelegt werden wie eine sportliche Fähigkeit.
Will ich das oder kann ich das einfach gut?
Wie komme ich also dazu, Dinge zu tun, die mir keine Freude bereiten?
Zwischen Wollen (“Jetzt!”) und Können (“Kann ich!”) spannt sich eine winzige, aber mächtige Brücke – ohne dass man sich dessen immer bewusst ist. Im Nucleus accumbens, diesem Herzstück des Antriebs im Gehirn, sitzen zwei Dopaminrezeptoren: D1, der uns nach vorn pusht, und D2, der uns erinnert: „Vorsicht, Schritt für Schritt!“ Normalerweise arbeiten sie getrennt – aber manchmal tun sie sich zusammen zu einem Doppelrezeptor, einem sogenannten Heteromer (Hasbi et al., 2011). Dann geschieht etwas Spannendes: Der Antrieb (das Wollen) koppelt sich direkt an gespeicherte Routinen (das Können). Plötzlich läuft eine Handlung wie im Autopilot, auch wenn das Herz dabei nicht vor Freude hüpft – Effizienz pur, oder eben: Jahre lang dieselbe Schleife wiederholen, nur weil’s funktioniert.
Unsere Handlungen tanzen manchmal ohne Musik – das Gehirn spielt die Melodie im Takt, auch wenn wir gerade nichts hören. Früher war das schlau, heute kann es zur Gewohnheit ohne Sinn verkommen. Aber genau dieser Mechanismus erklärt, warum man Dinge jahrelang macht, obwohl sie keinen Spaß mehr bringen – weil das Gehirn an der Gewohnheit festhält, mehr als an der Freude.
Viel von dem, was wir können bestimmt unsere Identität. Daraus strickt sich das Umfeld, die Lebensplanung und auch die Karriere (finanzielle Sicherheit und Anerkennung). Wir verbinden uns also mit unserem Können mit der Welt (zumindest im westlichen Standard) und ziehen daraus nicht selten unsere Daseinberechtigung.
D(opmain)1 und D(opamin)2
Lea steht am Rand eines Flusses, der sich zwischen glatten Felsen hindurchschlängelt. Das Wasser glitzert, kleine Stromschnellen rauschen. D1 springt sofort an: „Das könnte Spaß machen! Los, steig ins Boot und fahr los!“ – dieser Rezeptor liebt das Gefühl von Annäherung, von möglicher Belohnung, auch wenn sie noch weit weg ist. Gleichzeitig meldet sich D2, ein wenig skeptisch: „Hm, prüf erstmal die Strömung, vielleicht brauchst du eine Route, bevor du ins Wasser gehst.“
Weil beide gleichzeitig wach sind, passiert etwas Besonderes: Lea stürzt sich nicht kopfüber in die Fluten, aber sie bleibt auch nicht am Ufer stehen. Sie prüft den Wasserstand, testet das Paddel, steigt dann ins Boot und sucht die ruhigeren Strömungen. Der Mut von D1 trifft auf die vorsichtige Struktur von D2. Das Ergebnis? Eine sichere, aber entschlossene Fahrt – ein neues Abenteuer, das trotzdem machbar ist.
D1 Rezepotoren lieben Annäherung und Motivation, D2 Rezeptoren lieben die Routine.
Wie bei vielem ist das Motto: Use it or lose it!
Wer ständig dazu neigt, den D1-Kick (“Woohooo”) zu suchen und die langsfrstige D2-Gelassenheit (“Oooh yeah”), auslässt, verliert auch die jeweiligen Rezeptoren.
Obwohl das noch nicht alles zu diesem spannenden Dopamin-Engtanz ist, erklärt sich hier vielleicht, warum es so super schwer ist, seine Routinen zu ändern oder eben mal etwas durchzuziehen, wenn man es schon lange nicht mehr gemacht hat.
Ich fange hier jetzt nicht mit Sucht, Glaubenssätzen oder Social Media an, aber wahrscheinlich hast Du jetzt einen Einblick…
Und, mag ich das überhaupt?
Und doch, so mächtig diese Brücke zwischen Wollen und Können auch ist, sie erzählt nur einen Teil der Geschichte. Denn sie sagt nichts darüber, ob wir die Reise genießen. Das, was wir mögen, läuft über ein völlig anderes System.
Im Gehirn ist Mögen nicht der Motor, der uns loslaufen lässt, sondern die Oase, an der wir verweilen. Statt D1- und D2-Dopaminrezeptoren sprechen hier hedonische Hotspots: winzige Inseln, verstreut im Nucleus accumbens (shell), im ventralen Pallidum, im orbitofrontalen Kortex und in der Insula (Berridge & Kringelbach, 2015). Wenn sie anspringen, schütten sie nicht einfach mehr Dopamin aus, sondern ein Cocktail aus endogenen Opioiden, Endocannabinoiden und GABA – Stoffe, die kein Drängen erzeugen, sondern das satte Gefühl: „Genau so ist es gut.“
Franca Parianen beschreibt in Hormongesteuert ist immerhin selbstbestimmt (2020), wie dieser Unterschied im Alltag oft verwischt. Man denkt, man will etwas, weil man es mag – oder umgekehrt. Dabei ist es neurobiologisch klar getrennt: Das Wollen (Dopamin) ist die Hand, die zum Apfel greift. Das Mögen (Opioide, Endocannabinoide, GABA) ist der Biss in den Apfel, der süße Geschmack, das zufriedene Kauen.
Genau deshalb kann man eine Handlung über Jahre immer noch ausführen, weil D1 und D2 brav ihre Brücke halten – ohne dass die hedonischen Hotspots auch nur einmal gezündet haben. Und umgekehrt kann man etwas mögen, ohne es jemals zu tun, weil das Wollen fehlt. Wer diese Unterscheidung kennt, hört auf, sich darüber zu wundern, warum manche Ziele erreicht werden, ohne Freude zu bringen – und warum manche Freuden nie umgesetzt werden. Aber auch, warum einige Posts lesen, die meinen, dass man sich zum Sport quälen müsse oder Disziplin eine Tortur sei.
Man könnte sagen, dass Wollen, Können und Mögen, etwas sehr Persönliches ist!
Woher weiß ich nun was ich noch mag, will und – warum auch immer – kann?
Hier kommt das Konzept der Salience ins Spiel – der Bedeutungsfilter unseres Gehirns. Stell ihn dir wie eine Bühne vor, auf der jeden Moment dutzende Reize um Aufmerksamkeit buhlen: Geräusche, Gedanken, Erinnerungen, Pläne, Push-Nachrichten. Salience entscheidet, wer auftritt und wer im Backstage bleibt. Franca Parianen beschreibt, wie dieser Filter von Hormonen, unserer Sozialisation und von dem, was wir erlebt haben, mitgestaltet wird.
Das heißt: Hormone können Scheinwerfer setzen – Cortisol rückt Bedrohungen in grelles Licht, Dopamin lässt Ziele funkeln, Oxytocin betont Nähe und Vertrauen. Sozialisation bestimmt, welche Rollen überhaupt besetzt werden: In manchen Kulturen ist Leistung der Star, in anderen Gemeinschaft. Und unsere Erfahrungen legen fest, welche Reize unser Gehirn als „Das ist wichtig!“ abspeichert.
In einer Welt, in der dauernd Signale eintreffen – Nachrichten, Likes, gesellschaftliche Erwartungen –, kann dieser Filter leicht übersteuern. Dann blendet er uns mit ständigem „Guck hierhin! Mach das jetzt!“, ohne zu prüfen, ob es sich lohnt. So entsteht, was Kent Berridge „wanting without liking“ nennt: Wir rennen Zielen hinterher, deren Erreichen keinen echten Genuss bringt – einfach, weil sie auf unserer inneren Bühne immer im Scheinwerferlicht stehen.
Thanks for nothing…
Das Schwierige daran: Im Tun selbst ist selten klar, aus welcher Strömung eine Handlung geformt ist. Eine Meditation kann aus dem Wollen kommen – der Drang, besser zu werden oder ein Ziel zu erreichen. Sie kann aus dem Mögen stammen – die Freude am stillen Sitzen, am Atem, am Klang einer Glocke. Oder aus dem Können – eine eingeübte Praxis, die in Fleisch und Blut übergegangen ist. Dasselbe gilt für Selbständigkeit, berufliche Karriere, Freundschaften oder Liebe: Jeder dieser Lebensbereiche kann aus jedem der drei Ströme gespeist sein, und oft verschränken sie sich so, dass die Quelle kaum noch zu erkennen ist.
Wer diesen Bedeutungsfilter versteht, erkennt nicht nur, welche Reize er gerade hochdreht, sondern auch, wann er uns auf eine falsche Bühne lockt. Und wer das unterscheiden lernt, gewinnt nicht nur Selbstkenntnis, sondern auch die Freiheit, bewusst zu steuern, wann welche Stimme im inneren Chor den Kurs bestimmt.
Aus dieser Perspektive ist klar: Andere Strategien sind gefragt. Strategien, die nicht jede Strömung einzeln optimieren wollen, sondern ihr Zusammenspiel. Das bedeutet: den Pusher im Zaum halten, den Verwalter auch mal pausieren lassen, mit dem Genießer ein rendez-vous ausmachen – und zu erkennen, wann welcher Ton zu laut geworden ist.
Bear, Mark F., et al. Neuroscience: Exploring the Brain. 4th ed., Wolters Kluwer, 2016.
Berridge, Kent C., and Morten L. Kringelbach. “Pleasure Systems in the Brain.” Neuron, vol. 86, no. 3, 2015, pp. 646–664.
Berridge, Kent C., and Terry E. Robinson. “Parsing Reward.” Trends in Neurosciences, vol. 26, no. 9, 2003, pp. 507–513.
Hasbi, Ahmed, et al. “A Possible Role for Dopamine D1-D2 Receptor Heteromers in the Psychostimulant Effects of Cocaine.” Journal of Biological Chemistry, vol. 286, no. 12, 2011, pp. 11214–11225.
Parianen, Franca. Hormongesteuert ist immerhin selbstbestimmt. Rowohlt, 2020.
Purves, Dale, et al. Neuroscience. 6th ed., Oxford University Press, 2018.
Schultz, Wolfram. “Neuronal Reward and Decision Signals: From Theories to Data.” Physiological Reviews, vol. 95, no. 3, 2015, pp. 853–951.